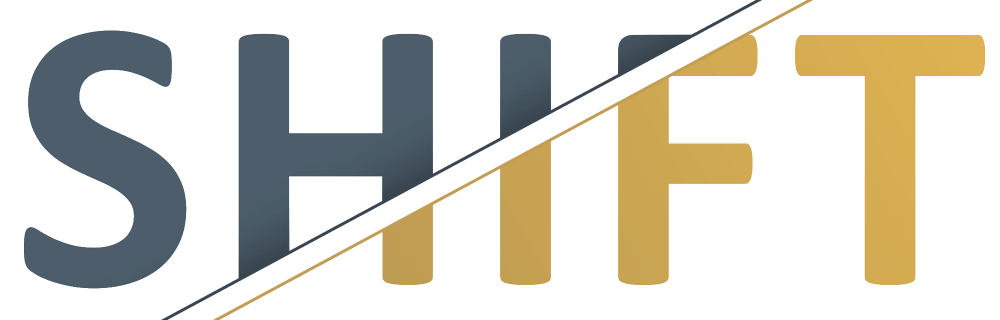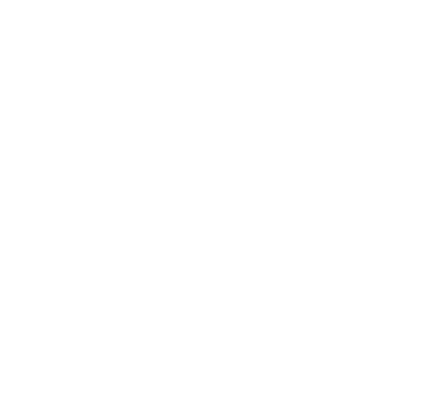Die Basis der „Nanotechnologie ist“ – einfach ausgedrückt – die Kontrolle des Bausteins Atom. Auslöser der Nanotechnologie-Diskussion ist der amerikanische Physiker Feynman. Im Rahmen seines vielzitierten Vortrages von 1959: „There is plenty of room at the bottom“ gab er einen ersten Ausblick auf die Möglichkeiten, die in der Kontrolle kleinster Einheiten und der damit verbundenen Möglichkeiten der Miniaturisierung verborgen liegen.
Der Begriff Nanotechnologie wird synonym verwendet mit „Molekulartechnologie“ und wurde vorwiegend durch Eric Drexler geprägt. In seinem Buch „Engines of Creation“ (1986) beschreibt er – übrigens auf Grundlage der Arbeiten von Feynman – die Möglichkeit der Erzeugung molekularer Maschinen, die in der Lage sind, Atome zu Molekülen zu verknüpfen und so neue Objekte von innen nach außen aufbauen können. Der Schlüssel liegt seiner Meinung nach in einer kontrollierbaren Selbstorganisation des Aufbaus („Self-Assembly“).
Die NASA definiert Nanotechnologie wie folgt:
Nanotechnologie ist die Herstellung von funktionellen Materialien, Hilfsmitteln und Systemen durch Kontrolle des Geschehens sowie die Erforschung von neuen Phänomenen und Eigenschaften (physikalisch, chemisch und biologisch) auf einer Nanometer-Skala (1-100 nm ).
Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gibt folgende Definition:
Nanotechnologie umfasst die technologische Nutzung von physikalischen, d.h. mechanischen, elektronischen und optischen Phänomenen, die für die Nanometerskala charakteristisch sind; nicht darunter fällt die bloße Verkleinerung heutiger Mikrostrukturen im Mainstream einschließlich der Mikroelektronik und Phänomene, die durch einzelne Moleküle erzielbar sind.
Deutlich unterscheiden sollte man die Nanotechnologie von der „Mikrotechnologie“. Während die Mikrotechnologie als sogenannte Top-Down-Technologie mit mehr oder weniger herkömmlichen Verfahren versucht, zu immer kleineren Strukturen und Systemen zu gelangen, überwiegt bei der Nanotechnologie der Bottom-Up-Ansatz. Hier geht man von kleinsten Einheiten (Atomen, Molekülen) aus und versucht, biologische, chemische oder physikalische Systeme „von unten“ aufzubauen. Zwar beruhen viele der heute bekannten Nanotechnologie-Entwicklungen auf dem aus der Mikrotechnologie bekannten Vorgehen (Top-Down), doch sind dem Vordringen in molekulare Bereiche hier natürliche Grenzen gesetzt. Die Kontrolle von Atomen als Bausteinen der Materie ist über diesen Weg nicht möglich. Wirklich bahnbrechende Entwicklungen der Nanotechnologie werden aber nur über diese Schiene realisiert werden können.
Gegenstand der Nanotechnologie ist insbesondere auch die Nutzung neuer Funktionen, die einerseits auf der geometrischen Größe, andererseits aber auch auf den materialspezifischen Eigenschaften der Nanostrukturen basieren. Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie sind aus heutiger Sicht nahezu unbegrenzt. Mittlerweile gibt es erste erfolgreiche industrielle Anwendungen, die sich aber wenig spektakulär meist auf die Verbesserung bestehender Produkte zentrieren. Vom Traum der Nanotechnologen, einer Art selbstreplizierendem Nanoroboter (siehe „Selbstreplizierende Systeme“), der in seiner Umgebung gezielt und kontrollierbar Aufgaben verfolgt (z.B. winzige Roboter, die in den Blutgefäßen eigenständig krankhafte Ablagerungen beseitigen), sind wir allerdings sicherlich noch Jahrzehnte entfernt.