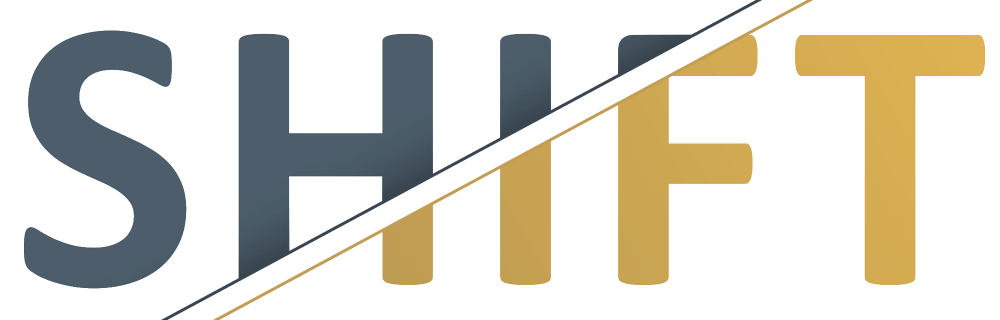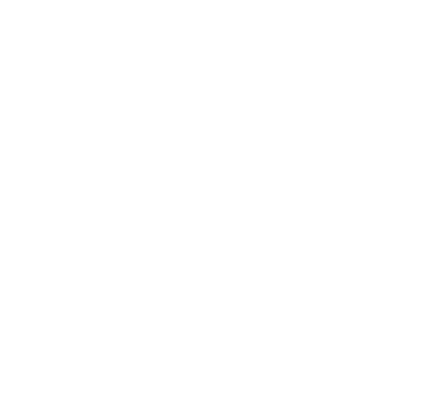Digitale Transformation versus Digitalisierung
Viele Unternehmer fühlen sich in Bezug auf die Digitalisierung in Zugzwang und damit ihrer unternehmerischen Freiheit beraubt. Unklar ist oft, wie der passende und gleichzeitig pragmatische Ansatz für die individuelle Digitalisierung aussieht.
Das liegt daran, dass Unternehmen mit isolierten Produkten, Lösungen und Beratungsangeboten für Teilbereiche der Digitalisierung geradezu bombardiert werden: Enterprise Resource Planning, digitales Dokumentenmanagement, Collaboration-Tools, Workflowmanagement, Prozessautomation, Vernetzung der Fertigung, Sensoren, Big Data, Robotik, KI usw.
Diese verstellen aber den Blick auf das Wesentliche. Wenn Unternehmer auf diese einseitig technischen Lösungen setzen, bleibt die Digitalisierung häufig auf halbem Wege stecken.
Der Nachteil dieser isolierten Maßnahmen ist, dass sie die Vogelperspektive vernachlässigen: Die erfolgreiche und zukunftsgewandte Transformation eines Unternehmens bezieht die Kategorien Innovation, Wertschöpfung, Organisation, Wettbewerber und Kunden mit ein.
Das Ziel einer digitalen Transformation – im Unterschied zur technischen Digitalisierung – ist es, Ihr Unternehmen so aufzustellen, dass es die Herausforderungen der Digitalisierung dauerhaft bewältigen und die darin liegenden Chancen aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft und von innen heraus für sich nutzen kann.
Unser Ansatz
Unser Ziel ist es, einen kontinuierlichen Prozess der digitalen Transformation dauerhaft in Ihrem Unternehmen zu verankern. Dieser Prozess wird von Ihnen immer wieder durchlaufen, um eine stetige Entwicklung von einem digitalen Reifegrad zum nächsten sicherzustellen. Dieser Prozess besteht aus vier Phasen:
Roadmap: Das Ziel der digitalen Roadmap ist es, die in der Digitalstrategie zu jedem strategischen Ziel hinterlegten strategischen Initiativen in eine zielführende kausale Reihenfolge zu bringen. Eine strategische Initiative besteht aus einem Bündel von Maßnahmen zur Erreichung des zugehörigen strategischen Ziels. Zu Beginn dieser dritten Phase unseres Ansatzes beantworten wir mit Hilfe einer weiteren Organisationsanalyse allerdings zunächst die Frage, ob Ihre Organisation die mit der digitalen Transformation einhergehenden Veränderungen bewältigen kann.
SHIFT: In dieser Phase werden die strategischen Initiativen entsprechend der digitalen Roadmap umgesetzt. Je nach Umfang der Transformation kann es sich um ein einzelnes Digitalisierungsprojekt oder viele solcher Projekte handeln, die in einem Programm durchgeführt werden. Da die Veränderung von Organisationen und die Entwicklung von Menschen im Zuge einer digitalen Transformation eine komplexe Herausforderung ist, empfehlen wir ein exploratives, agiles Vorgehen in Anlehnung an das Scrum Framework.
Die einzelnen Phasen haben Rückwirkungen auf vorherige Phasen. Während der Entwicklung der digitalen Roadmap stellen wir zum Beispiel manchmal fest, dass eine strategische Initiative oder ein strategisches Ziel in der Digitalstrategie fehlt.
Nach Ende der vierten Phase beginnt der Prozess wieder bei der ersten Phase, um die nächste Reifegradebene zu erklimmen. Denn der Markt entwickelt sich ständig weiter – und zwar mit zunehmender Dynamik.
Das SHIFT-Reifegradmodell
Wir haben – basierend auf Forschungsarbeiten, die 1990 ihren Anfang nahmen – ein digitales Reifegradmodell mit neun Reifegradebenen entwickelt. Es umfasst alle Bereiche einer ganzheitlichen Digitalstrategie: Kunde, Organisation, Wertschöpfung, Innovation und Wettbewerber.

Es berücksichtigt den evolutionären Charakter von Organisationen, wie er in der S-Matrix (siehe das Buch Der Organisations-Shift) beschrieben ist. Das SHIFT-Reifegradmodell basiert somit auf der wechselseitigen Beziehung zwischen Markt und Unternehmen bzw. der betrachteten Organisationseinheit. Der Digitalisierungsgrad des jeweiligen Marktes bestimmt, wie eine Organisation aufgebaut sein und wie sie handeln muss, um erfolgreich zu sein.
Dieses digitale Reifegradmodell ist eine wesentliche Grundlage des SHIFT-Ansatzes. Folgende Einsichten und Erkenntnisse aus diesem Modells machen unser Vorgehen so erfolgreich:
- Die Natur des Marktes eines Unternehmens definiert seine Organisationsform.
- Der Digitalisierungsgrad des Marktes bestimmt daher auch den notwendigen Digitalisierungsgrad des Unternehmens.
- Hierarchiearme Organisationsformen, wie agile Organisationen oder Schwarmorganisationen, sind nur dann notwendig, wenn der Markt eines Unternehmens von der Digitalisierung geprägt wird.
- Dann allerdings – in smarten Märkten – sind solche Organisationsformen zwingend erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Eine neue Organisationsform kann nicht „einfach so“ eingeführt werden. Die Persönlichkeit der Menschen in einem Unternehmen – sein Mindset – entscheidet darüber, was möglich ist.